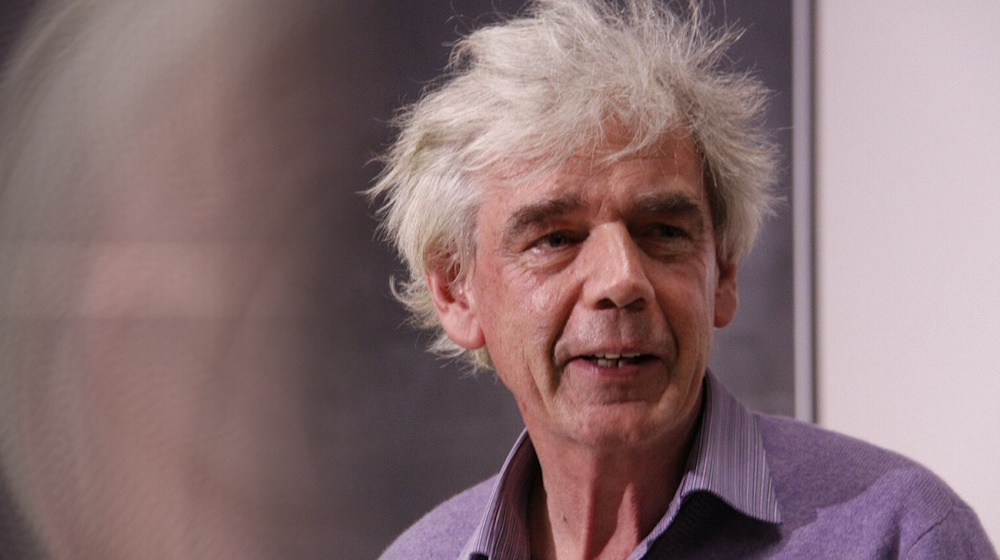In seinen Büchern greift der irisch-mexikanische Politikwissenschaftler John Holloway (* 1947 in Dublin) auf zapatistische, unorthodox-neomarxistische und anarchistische Theorieansätze zurück und entwickelt sie weiter. Im Januar 2025 erschien in der GWR 495 unter dem Titel „Hoffnung in hoffnungslosen Zeiten?“ ein Interview mit ihm. Diesmal dokumentieren wir Auszüge einer Rede, die er am 9. Mai 2025 an der Harvard Business School gehalten hat. Der Titel „Die Mitte hält nicht länger“ nimmt Bezug auf William Butler Yates’ Gedicht „The Second Coming“ („Die zweite Ankunft“), das erstmals 1920 veröffentlicht wurde und die Vision einer vollständigen Bedrohung der Menschheit schildert, in der alle Moral von den Menschen abgefallen und eine erwartete zweite Offenbarung durch Unheil unklarer Natur gefährdet ist (1). Die in den letzten Jahren in politologischen Analysen zu großer Bekanntheit gelangten Zeilen „Things fall apart; the centre cannot hold“ („Die Dinge zerfallen; die Mitte hält nicht länger“) stehen sinnbildlich für eine sich anbahnende große Krise mit hohem Vernichtungspotenzial. (GWR-Red.)
1. Gaza. Zu hoffen heißt, das Unsagbare zu sagen.
Gaza. Das deutlichste Zeugnis des Schmerzes in der heutigen Welt. Schmerz. Widerstand. Hoffnung.
Gaza. Wenn ich hierherkomme, um in jenem Land zu sprechen, das der wichtigste Förderer und Unterstützer des gnadenlosen und systematischen Tötens und Verstümmelns von Abertausenden Menschen, viele davon noch Kinder – die Vernichtung der Hoffnung – ist, dann kann ich dies nur unter lautstarkem Protest tun, der mein Zögern über meine Entscheidung zum Ausdruck bringt.
Gaza. Ich komme trotz meiner Zweifel hierher, um meine Solidarität mit Euch, die ihr in diesem Land lebt, trotz der Regierung, unter der ihr jetzt leidet und der Regierung, die ihr zuvor erlitten habt, zum Ausdruck zu bringen. Und um meinen Respekt für die Organisator:innen einer solchen Veranstaltung mit so subversiven Worten wie Rasse, Geschlecht und Gerechtigkeit auszudrücken. Und für Euch alle, die ihr, auf die eine oder andere Weise, in die falsche Richtung geht.
Gaza, da nichts den Horror des gegenwärtigen Kapitalismus, die furchtbaren Folgen eines durch das Geld beherrschten gesellschaftlichen Systems, deutlicher illustriert.
Gaza, weil wir das Schweigen brechen müssen, das furchtbare Schweigen der Komplizenschaft, das über der Welt schwebt, die Normalisierung der Hoffnungslosigkeit.
Hoffnungslosigkeit umgibt uns. Sie hat viele Namen: Gaza, Sudan, Ukraine, der Klimawandel, das Massaker an der Biodiversität, Trump, Milei, Orbán, Putin, die wachsende Bedrohung durch einen Atomkrieg. (2) Und doch, mitten im Zentrum, sind wir hier zusammengekommen, um NEIN zu sagen, es ist an der Zeit, über radikale Hoffnung zu sprechen.
Wir können die Hoffnungslosigkeit nicht akzeptieren, denn sie tötet alles wissenschaftliche Denken. Uns ist nur noch eine wissenschaftliche Frage geblieben: Wie brechen wir die gesellschaftliche Dynamik, die uns zur Selbstzerstörung der Menschheit treibt? Diese Frage kann nicht mit Hoffnungslosigkeit beantwortet werden. Hoffnungslosigkeit ist die Weigerung nach einer Antwort zu suchen, ein Aufgeben, eine Komplizenschaft, gleich wie widerstrebend auch immer.
Also NEIN zur Hoffnungslosigkeit. Aber das führt uns nicht zu einer geistlosen Hurra-Hoffnung. Es gibt ein dem Begriff Hoffnungslosigkeit verwandtes Wort, das aber auch eine andere Bedeutung trägt: Verzweiflung.
Verzweiflung ist nicht Hoffnungslosigkeit. Es ist die Weigerung, ohne Hoffnung zu sein, eine Weigerung, unsere Wut und Hoffnung aufzugeben, selbst in einer Welt, die uns sagt, wir sind verrückt, weiterhin daran zu glauben, dass eine andere Welt möglich sei. In Wörterbüchern wird Verzweiflung oft mit Hoffnungslosigkeit gleichgesetzt, aber dies trifft es nicht. Ich habe eine Definition gefunden, die dem, was ich fühle, näherkommt: „Verzweifelt: den Willen zu zeigen, jegliches Risiko auf sich zu nehmen, um eine schlechte oder gefährliche Situation zu ändern“. Vielleicht nicht „jegliches Risiko“, aber ja, ein Zorn um eine schlechte oder gefährliche Situation zu ändern, eine Entschlossenheit, eine schlechte Situation zu ändern, die schlechte Situation, die der gegenwärtige Kapitalismus ist. Verzweiflung, die Welt zu ändern, da wir wissen, dass sie nicht so sein muss, dass wir die Fähigkeit besitzen, etwas anderes zu erschaffen. Verzweiflung schließt Frustration über das ein, was wir machen könnten, Frustration unseres Reichtums, unserer Fähigkeit, etwas anderes zu erschaffen.
Verzweiflung ist die Hoffnung im Sturm, Hoffnung in-und-gegen den Sturm, Hoffnung in-gegen-und-jenseits des Sturmes. Vielleicht besteht die einzige Art und Weise heute über radikale Hoffnung zu sprechen, darin, sie als Verzweiflung zu bezeichnen. Hoffnung als die Negation der Anti-Hoffnung. Hoffnung als Widerstand.
Diejenigen, die solche Sachen verfolgen (und ihr solltet dies tun, denn sie sind diejenigen, die seit mehr als dreißig Jahren die Hoffnung am deutlichsten zum Ausdruck bringen) werden merken, dass in meinem Hervorheben des Begriffs Verzweiflung, die Rede von Marcos auf dem von den Zapatistas organisierten Treffen im Dezember widerhallt. Die Herausforderung, so legte er damals dar, liege darin, „unsere Verzweiflung zu organisieren“. (3)
2. Wahrscheinlich teilen alle hier Anwesenden das Gefühl der Verzweiflung. Der Kapitalismus bringt Verzweiflung hervor. In allen möglichen Formen. Auf einer persönlichen Ebene, die tiefe und zunehmende Unsicherheit des Lebens: Wie kann ich an die Uni gelangen, einen Arbeitsplatz oder eine Festanstellung erhalten? Wie kann ich eine Wohnung finden. In welcher Welt werden meine Kinder leben? Sollte ich überhaupt Kinder in so eine Welt bringen? Dies alles ist Teil einer zunehmenden gesellschaftlichen Verzweiflung: seht was mit den Migrant:innen passiert, schaut auf die Biodiversität, von der das menschliche Leben abhängt und die gerade zerstört wird, seht auf den Klimawandel, der zunehmend außer Kontrolle gerät, seht auf den Aufstieg der neuen Rechten, seht auf die wachsende Gefahr weiterer Kriege.
Aber wo sollen wir mit unserer Verzweiflung, unserer trotz allem bestehenden Hoffnung hin?
Das Offensichtlichste in der gegenwärtigen Situation ist, wieder zur Mitte zurückzudrängen, zu hoffen, dass die Demokraten die Zwischenwahlen in den USA gewinnen, dass weder Trump noch Vance die Wahlen 2028 gewinnen werden, dass wir in zehn Jahren auf Orbán, Meloni, Modi, Erdoğan, Trump wie auf einen schlechten Traum, ein unseliges Anzeichen, zurückschauen werden, dass es eine Rückkehr von Etwas geben wird, das wir als Zivilisation erkennen werden.
Die Mitte hält nicht länger. Offensichtlich hat hier in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern die Mitte nicht gehalten. Dennoch verbleibt sie dort als nostalgischer Magnet, ein unwiderstehlicher Anziehungspunkt zur Welt, die um uns herum zerbricht.
Dieser nostalgische Antrieb zu einer Rückkehr zur Normalität ist wahrscheinlich unvermeidbar, vielleicht gar wünschenswert. Und dennoch müssen wir bedenken, dass die Mitte nicht gehalten hat, nicht halten konnte und dass wir deswegen über den Kampf zu dessen bloßer Wiederherstellung hinausgehen müssen.
3. Wir betrachten die Mitte jetzt durch die Perspektive der gegenwärtigen Attacke. Die Angriffe auf kritisches Denken in den Universitäten, die Angriffe auf Migrant:innen, die Auflösung der gesetzesbasierten Weltordnung und so weiter. Allgemeiner können wir uns die Mitte vielleicht als eine Art weltweiten Gesellschaftsvertrag vorstellen, eine Art von Normalität, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde und die die Idee der Demokratie als wünschenswert, Mindestniveaus gesellschaftlichen Wohlstands, ein gewisses Verständnis von Politik, der Art von Beziehungen, die zwischen Staaten herrschen sollten, einer Vorstellung der Menschenrechte und des Rechtsstaats umfasst.
Wir sollten für die Verteidigung der liberalen Demokratie kämpfen, aber wir müssen darüber hinaus schauen, weitergehen und fragen, ob die gegenwärtige Situation einen Durchbruch in der Entwicklung einer radikalen Politik der Hoffnung erschaffen könnte.
Ich möchte diese Normalität nicht idealisieren. Sie ist eine Phase der Zivilisation des Geldes, eine mörderische Zivilisation, die auf Ausbeutung, Rassismus, Sexismus, Kolonialismus, Unterdrückung, Inhaftierung und der Zerstörung anderer Lebensformen aufbaut. Nichtsdestotrotz gibt es eine Form der Normalität, eine Form des Gesellschaftsvertrages, die manchmal als keynesianischer Wohlfahrtsstaat bezeichnet wird, die dann von dem, was viele als Neoliberalismus bezeichnen, angegriffen wird, der aber, insbesondere von der Gegenwart aus betrachtet, mehr Kontinuität aufwies, als es den Anschein hat: dasselbe System von Beziehungen zwischen Staaten, ein symbolischer Respekt der Demokratie, der Menschenrechte und des Rechtsstaates.
4. Diese Mitte wird im Anschluss an die globale Finanzkrise von 2008 zunehmend in Frage gestellt. Es wird deutlich, dass sie nicht als gegeben erachtet werden kann.
Unabhängig davon, ob man diese Normalität attraktiv findet oder nicht oder wenigstens besser als das, was jetzt durchgesetzt wird, gibt es mindestens zwei Gründe dafür, zu glauben, dass sie nicht länger realistisch ist.
Zuerst einmal gab es dafür eine materielle Grundlage. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie das Ergebnis einer großen Umstrukturierung des Kapitals, die durch die Zerstörung und das Gemetzel des Krieges erreicht wurde. Dieser Aufschwung der Produktivität und Profitabilität kam seit den 1960er und 1970er Jahren zunehmend unter Druck. Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-System (4) und der Neuorientierung der Politik unter Reagan und Thatcher hing die Reproduktion des Kapitalismus zunehmend von der beständigen Ausweitung der Schulden ab, das heißt, nicht von tatsächlich produziertem Mehrwert, sondern von der Erwartung einer zukünftigen Produktion von Mehrwert. In den letzten vierzig Jahren hat es eine beispiellose Ausweitung der Schulden im weltweiten Maßstab gegeben und dies hat zu einer Ausweitung der systemischen Fragilität geführt, ein Ausdruck der Kluft zwischen der Akkumulation des Werts und dessen Ausdruck in Geldform. Diese Fragilität wird im Wesentlichen von der US-amerikanischen Federal Reserve und anderen Zentralbanken verwaltet, aber während der Finanzkrise von 2007/2008 hat sie exponentiell zugenommen und die latente Drohung des Zusammenbruchs besteht weiterhin dauerhaft. Anders ausgedrückt, ist die ökonomische Grundlage der Normalität, an die wir uns gewöhnt haben, zunehmend zerbrechlich geworden. Anstatt also eine Politik des siegreichen Kapitals zu sein, ist (oder war) der Neoliberalismus die Politik seiner Krise.
Der andere Grund dafür, die Möglichkeit der Wiederherstellung der Mitte in Frage zu stellen, ist das Ausmaß an Wut und Verzweiflung, die sie hervorgebracht hat. Das Versprechen wachsenden persönlichen Wohlstandes im Gegenzug für die Akzeptanz des Systems und das Verschließen unserer Augen vor dessen zerstörerischer Kraft, ein zentraler Bestandteil des Nachkriegsgesellschaftsvertrages, wurde über die letzten ca. vierzig Jahre für den Großteil der Bevölkerung nicht eingelöst.
Die scheinbar zufällige Akkumulation gigantischen Reichtums in den Händen einiger Weniger hat dazu beigetragen, die Wut in Ressentiment zu verwandeln. Wie Abahlali baseMjondolo, die wichtige Bewegung der Armen und Slumbewohner:innen in Südafrika, nach den Unruhen im Juli 2021 gesagt hat: „Abahlali hat immer davor gewarnt, dass sich die Wut der Armen in viele Richtungen entwickeln kann. Wir haben immer wieder davor gewarnt, dass wir auf einer tickenden Zeitbombe sitzen“. (5)
Die Mitte, die Normalität der zurückliegenden Jahre, baute auf zwei Zeitbomben auf: die finanzielle Fragilität und wachsendes Ressentiment. Es ist wahrscheinlich weder wünschenswert noch realistisch, sie wiedererstehen zu lassen. Wir sollten sicher für die Verteidigung der liberalen Demokratie kämpfen, aber wir müssen darüber hinaus schauen, weitergehen und fragen, ob die gegenwärtige Situation einen Durchbruch in der Entwicklung einer radikalen Politik der Hoffnung erschaffen könnte.
5. Wenn die Mitte nicht länger hält, kann es dann die Rechte? Wir können es nicht wissen. Sie drängt uns sicher in Richtungen, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen, in Bezug auf die Zerstörung des Klimas und die Möglichkeit eines Atomkrieges, vielleicht wird es ihr gelingen, der Menschheit einen Alptraum zu bescheren. Aber es ist ebenso gut möglich, dass sie, angesichts des Widerstandes der Bevölkerung auf der einen Seite, und, paradoxerweise, auf der anderen Seite aufgrund der Kräfte des Marktes, das heißt, aufgrund ihres Unvermögens, die Realitäten der Macht des Geldes zu verstehen und zu akzeptieren, zusammenbrechen wird.
Worin also besteht die Hoffnung in dieser Situation?
Zuerst einmal muss sie ein Schrei der Verweigerung, ein NEIN, sein. Ich würde denken, dass wir das hier alle teilen. Es stellt sich in den Massenprotesten der letzten Wochenenden dar und es ist zu hoffen, dass sie weiterhin wachsen werden.
Aber wohin bringt uns dieses NEIN?
Vielleicht wieder zurück in die Mitte, die liberale Demokratie. Möglicherweise werden in den nächsten Wahlen die vernünftigen Menschen gewinnen, werden die Missgünstigen verlieren. Aber dann wird die Zerbrechlichkeit weiterhin wachsen und auch das Ressentiment.
Es muss uns gelingen, die ressentimentgeladene Wut, die hinter dem Aufstieg der Rechten steht, als unsere zu reklamieren. Unsere Antwort kann nicht sein: „Seid vernünftig, stellt Eure Wut zurück!“
Auch unsere Wut richtet sich gegen ein System, das uns erniedrigt und tötet. Lassen sich die unterschiedlichen Formen der Wut so kanalisieren, dass die totalisierende, tödliche Macht des Geldes geschwächt oder gebrochen wird, statt sie zu stärken? Hoffnung ist heutzutage die Aufgabe, auf welche Art und Weise wir unsere Wut kanalisieren.
Die Wut der Armen kann sich in viele Richtungen entwickeln, sagt Abahlali. Eine Richtung scheint derzeit dabei zu dominieren: Wut als Ressentiment. Aber es gibt auch eine andere Wut, die durch Tausende Bewegungen weltweit zum Ausdruck gebracht wird. Es handelt sich um das, was die Zapatistas „digna rabia“, nennen, was schwer zu übersetzen ist, vielleicht würdige Wut oder rechtschaffene Wut: eine Wut, die aus der täglichen Unterdrückung der existierenden Gesellschaft entspringt und uns auf eine Welt der gegenseitigen Anerkennung unserer Würde verweist. Anders ausgedrückt, eine Wut gegen die Art und Weise, in der gesellschaftliche Verhältnisse derzeit organisiert sind (Kapitalismus), die zur Erschaffung einer anderen Welt, eine Welt vieler Welten, drängt. Eine Wut gegen die Herrschaft des Geldes und ein Drängen zur Entwicklung des Lebens.
Eine Wut des Ressentiments und eine Wut der Hoffnung. Hier gibt es ein Problem der Grammatik der Identifikation. Das Ressentiment identifiziert, es richtet seine Wut gegen bestimmte Gruppen von Menschen, gleich ob Migrant:innen oder Akademiker:innen der Harvard Universität. Es wütet gegen die Elite als Gruppe von Menschen, stellt aber das System, das Eliten oder Migrant:innen hervorbringt, nicht in Frage. Der Aufstieg der Rechten ist eine Explosion identitärer Politik, die entmenschlichend wirkt, indem Gruppen von Menschen als Objekte oder abstrakte Kategorien behandelt werden. Identifizierung ist ein Prozess der von einer unbestimmten Wut ausgeht und sich auf bestimmte menschliche Objekte konzentriert, gleich ob sie Schwarze, Araber:innen, Jüdinnen und Juden, Ausländer:innen oder transsexuelle Menschen sind. Der Prozess der Identifikation wird durch rechte Gruppen gestärkt, er ist aber auch tief in die existierende Gesellschaft eingeschrieben. Der Staat ist ein Projekt der Identifikation. Seine Existenz selbst ist die Erklärung einer scharfen Unterscheidung zwischen „uns“ und jenen Anderen, Ausländer:innen, die wir misshandeln und, wenn nötig, töten können. Die Existenz des Staates selbst als Form gesellschaftlicher Organisation ist ein Prozess des „Zum-Anderen-Machen“ (6), eine Schule des Faschismus und des Krieges.
Eine Politik der Hoffnung geht von derselben Wut aus, die von der Rechten identifiziert wird, widersteht aber dem Prozess der Identifikation. Indem sie überfließt. Eine Politik der Hoffnung ist notwendigerweise eine anti-identitäre Politik, nicht in dem Sinne der Negation der Identität, sondern im Sinne der Bewegung in-gegen-und-darüber-hinaus. Wir sind Indigene aber unser Kampf geht darüber hinaus, für eine Welt, die auf der Anerkennung der menschlichen Würde begründet ist. Wir sind Kurden, eine unterdrückte Nation, aber unser Kampf geht darüber hinaus, für die Erschaffung einer anderen Art Welt. Wir kämpfen gegen den Klimawandel, aber wir wissen, dass es nicht nur eine Frage fossiler Brennstoffe ist, sondern ein Kämpfen gegen eine Welt, in der die Entwicklung vom Streben nach Profit geprägt ist. Wo eine identitäre Politik schließt und Antworten gibt, öffnet eine Politik der Hoffnung und stellt Fragen. Preguntando caminamos, fragend gehen wir, wie die Zapatistas es ausdrücken.
Eine Politik der Hoffnung ist eine Politik des Fragens, Suchens, Diskutierens. Seine Organisationsform hat eine lange Geschichte, die beständig erneuert wird: die Versammlung, der Rat, die Kommune, eine Organisationsform, die so beschaffen ist, dass die Äußerung von Meinungen und die Diskussion von Lösungen befördert werden, weit entfernt vom Staat oder der Partei, die die richtige Linie vorschreibt. Ein Ort wie dieser, an dem wir nicht übereinstimmen müssen, wo wir sagen können: „Dies möchte ich sagen. Was denkst du?“ Ein Ort, an dem Wut geteilt wird und Etikettierungen einfach durch dieses Teilen unlesbar werden.
6. Hoffnung ist folglich würdige Wut, eine Wut, die entschlossen ist, ein gesellschaftliches System abzuschaffen, das uns zerstört und stattdessen eine Welt zu erschaffen, die auf der gegenseitigen Anerkennung der Würde begründet ist. Wahnsinn, an die Harvard Business School zu kommen und zu sagen, dass wir den Kapitalismus abschaffen müssen. Und dennoch, ein notwendiger Wahnsinn. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass die Fortführung der existierenden Form gesellschaftlicher Organisation mit dem Überleben des Menschen unvereinbar ist. Sicher, der Kapitalismus ist seit jeher eine Kombination von Erschaffung und Zerstörung gewesen, aber mittlerweile wird seine zerstörerische Seite zunehmend beherrschend.
Hoffnung ist Wahnsinn. Hoffnung ist Verzweiflung, die auf dem Grat des Abgrunds der Hoffnungslosigkeit balanciert. Aber wir müssen unseren Wahnsinn annehmen, ihn laut und deutlich aussprechen. Denn wir müssen gewinnen. Dieses Mal, müssen wir, die ewigen Verlierer, gewinnen, wenn wir uns nicht zurücklehnen wollen und den Ritt in den Abgrund der Katastrophe, hinein in die mögliche Auslöschung, genießen wollen.
(1) http://www.luxautumnalis.de/william-butler-yeats-second-coming/
(2) Diese Aufzählung ist nicht vollzählig, kann es gar nicht sein. So müssen aus John Holloways Sicht, aber auch aus der Sicht des Offenen Marxismus, den Holloway, Bonefeld und viele andere begründet haben, sicher auch Putin und der russische Angriffskrieg sowie China, das unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei einen Herrschaftsanspruch auf bislang nicht zu seinem nationalen Territorium gehörige Gebiete erhebt, zu diesen Polen der Hoffnungslosigkeit gerechnet werden. Dass man im Zentrum der westlichen Hoffnungslosigkeit allerdings deren westliche Vertreter hervorhebt, sollte ebenfalls nicht verwundern; Anm.d.Ü.
(3) Beitrag „La Cofa del Vigía: Un largavista hacia el ayer“ (Der Mastkorb des Wachturms: ein langer Blick zum Gestern) von El Capitán Marcos über die Geschichte der Zapatistas auf dem internationalen Treffen „Encuentros de Resistencia y Rebeldía“ (Treffen des Widerstands und der Rebellion), das vom 28.-30.12.2024 vom Centro indígena de Capacitación Integral (CideCI; „Indigenes Zentrum zur integralen Ausbildung“), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko, organisiert wurde. Hier ist der spanische Originalbeitrag zu hören: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2024/12/27/transmision-en-vivo-de-las-mesas-de-la-primera-sesion-de-los-encuentros-de-resistencia-y-rebeldia/; Anm.d.Ü.
(4) Auf der Konferenz im US-amerikanischen Bretton Woods vom 1.-22.07.1944 wurde eine neue internationale Finanzarchitektur beschlossen, die die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds als UN-Institutionen begründete und auf der der Goldstandard mit festen Wechselkursen festgelegt wurde. Die Aufhebung des letzteren 1973 markiert das Ende dieser Phase und den Beginn des „Neoliberalismus“; Anm.d.Ü.
(5) Gemeint sind die auch als Zuma-Unruhen bekannten Aufstände in den Provinzen KwaZulu-Natal und Gauteng zwischen dem 9.-18.07.2021. Sie richteten sich gegen die Verhaftung des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma, der sich weigerte, in einem gegen ihn gerichteten Korruptionsverfahren auszusagen. Bei den Protesten starben 354 Menschen, Tausende wurden verhaftet. Die Stellungnahme von Abahlali baseMjondolo ist hier zu finden: https://abahlali.org/node/17320/
(6) i.O. „othering“; also die Heraushebung der eigenen sozialen Existenz gegenüber anderen Menschen, die dadurch zu „Fremden“ gemacht werden, was deren Ausschluss aus Gruppen rechtfertigt; Anm.d.Ü.
Übersetzung aus dem Englischen: Lars Stubbe, 18.05.2025