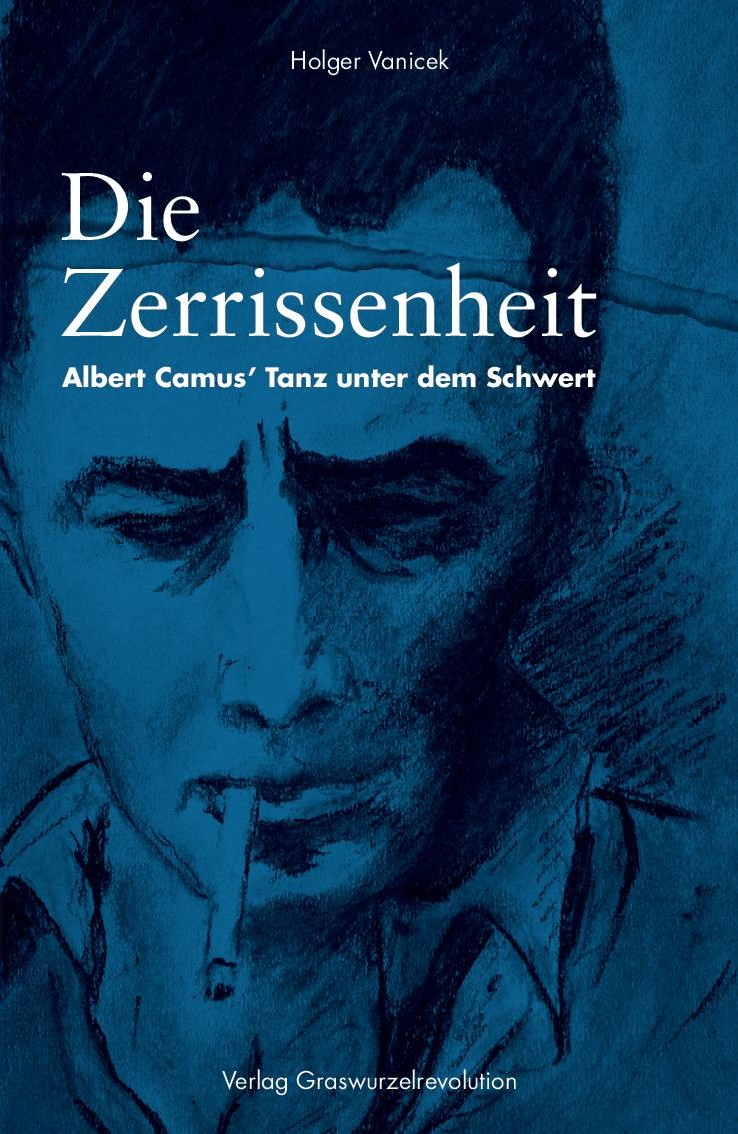Vorwort
Ein persönliches Vorwort
Hat sich nicht jeder einmal die Frage gestellt, was wäre, wenn man eine Ausnahme von allen anderen Menschen sei? Wie wäre es, würde ich aus irgendwelchen Gründen als einziger Mensch auf Erden ewig leben? Solche Fragen sind nicht bloß oberflächige Gedankenspiele, es steckt eine tiefere Empfindung in ihnen: Ich begreife mich als Ich-Selbst und es gibt kein zweites Wesen, mit dem ich dieses Selbst-Gefühl teile. Ganz im Gegenteil unterscheide ich alle Kreaturen außerhalb von mir als Die-Anderen. Insofern sehe ich mich selbst von Grund auf als eine Ausnahme. Dass ich den gleichen Regeln unterworfen bin, ist eine Erfahrung, die mir von außen beigebracht wurde, keine innere Wahrnehmung. In meiner Unterscheidung von den anderen, wie auch immer sie mir bewusst wird, bleibe ich mir schließlich selbst treu.
Mit dieser Wahrnehmung bin ich in besonderer Weise in meine Pflicht genommen: Ich trage keine kollektive sondern eine aus mir selbst entstehende Verantwortung. Leider drängt es viele Menschen dazu, dieser Verantwortung zu entweichen und lieber in der Masse (dem Seienden) unterzutauchen und sich als Teil eines Ganzen selbst vergessen zu wollen.
Zwischen Sich-Selbst-Sein und Für-Andere-Sein tut sich eine ungeheure Spannung auf, es ist der am meisten bestimmende Faktor des Bewusstseins unserer Existenz. Inmitten dieser beiden Pole entsteht die Energie, die wir „Leben“ nennen. Wir wissen demnach aus ureigener Erfahrung, dass Energie nicht nur fließt: Sie tobt, baut sich auf uns entlädt sich, sie setzt in Gang, sie zerreißt.
Sprache finden
Über Monate hinweg war ich hin und her gerissen, ob ich mich einer Ausarbeitung der Zerrissenheit bei Albert Camus stellen sollte. Schließlich bin ich kein ausgebildeter Geisteswissenschaftler, habe mich zwar mit vielen Denkern auseinandergesetzt, jedoch nicht so systematisch, wie es ein Akademiker tun würde.
Seit ich mich mit Albert Camus beschäftige, ist das Thema immer mehr in meinen Fokus gerückt. Gleich die erste Novelle, die ich von ihm gelesen habe, „Die Stummen“, ist ein Paradestück über die Zerrissenheit. In den folgenden Jahren stieß ich auf viele entsprechende essenzielle Szenen in seinen großen Romanen, Novellen und Theaterstücken, auf wichtige Abschnitte in seinen philosophischen Schriften, seinen Artikeln und Reden. Die Zerrissenheit war aber nicht alleine ein geistiges Motiv, das Camus beschäftigt hat, er hat sie oft auch selbst schmerzlich durchlebt. Ausgewichen ist er ihr nicht, er wusste, dass man sich einem Zwiespalt, wenn man sich nicht selbst verleugnen will, und den oftmals daraus resultierenden Zerreißproben stellen muss. Camus hat Haltung bewiesen.
In meiner Jugend habe ich mich entschieden, Bildhauer zu werden, dem bin ich bis heute treu geblieben, parallel habe ich später eine weitere Leidenschaft zu meiner Berufung gemacht und Romane geschrieben. Mich dem Thema anhand künstlerischer Mittel anzunähern, entspricht demnach meinem OEuvre. Entstanden ist zuletzt mein Roman „Die Unendlichkeit geteilter Tage“ (1), der gleich mehrere parallel verlaufende Ausgangspunkte hat, von denen ganz konkret einer „Die Zerrissenheit bei Albert Camus“ lautet. Damit hätte ich mich zufriedengeben können.
Mein Vorhaben, dem Sujet noch einmal analytisch auf den Grund zu gehen, liegt wohl daran, dass mich das Thema nicht loslässt. Einerseits erkenne ich bei Camus zahlreiche Ansatzpunkte, andererseits beobachte ich, wie wenig Bereitschaft in unserer heutigen (und wohl auch früheren) Gesellschaft besteht, sich dem Zwiespalt zu stellen, der sowohl in gesellschaftlichen wie politischen Belangen aufkommt, als auch dem, der in jedem einzelnen Menschen tobt.
Heute beginne ich mit dem, was bereits mein Protagonist in meinem Roman getan hat: Ich nehme mir Schriften von und über Camus vor, dazu noch die von weiteren Denkern (in erster Linie denen, mit denen sich seinerzeit auch Albert Camus beschäftigt hat), um eine Arbeit über die Zerrissenheit bei Albert Camus zu schreiben, und damit einen Ausgangspunkt zu schaffen, der möglicherweise anderen dazu dient, sich weiter in das Thema zu vertiefen. Das Studium zahlreicher Sekundärliteratur über Camus hat diese Arbeit zusätzlich begleitet.
Ungeschriebenen Gesetzen zum Trotz, nach denen man eine akademisch-systematische Grundlage für das Verfassen eines wissenschaftlichen Werkes haben muss, und der Ermutigung von Prof. Dr. Dr. Heinz Robert Schlette, einer der wichtigsten Camus-Forscher folgend, beginne ich nun also mit einer Arbeit, von der ich schon viele Vorstellungen habe, aber nicht genau weiß, wohin sie mich führen wird. Verzeihen Sie mir also, wenn ich gewisse Aspekte nicht beachtet habe, und treten Sie in einen offenen Dialog, der als Ausgangspunkt für neue Erkenntnisse dienen mag.
Meine Zerrissenheit
Noch bevor ich auf Albert Camus’ Werk stieß, hatte ich meine größte eigene Zerrissenheit schon beinahe hinter mich gebracht. Lange Jahre hatte ich mit der Existenzfrage gehadert. Meine Vernunft hatte mich schon weit gebracht, mit ihr konnte ich dem Wissen um die Vergänglichkeit des eigenen Daseins fast spielerisch umgehen. Doch das tief innen sitzende, schmerzende Gefühl, dass mich vor allem dann überkam, wenn nichts von mir ablenkte, konnte ich einfach nicht in eine positiv gestimmte Bahn lenken.
Auslöser dieser wiederkehrenden Depression war der Tod meines Vaters. Der so sicher geglaubte Boden, auf dem die Endlichkeit als ein Abstraktum seine Tänze vollführte, derweil sich mein eigenes Leben wie ewig anfühlte, war mir unter den Füßen weggezogen worden, der folgende Sturz ließ sich zwar hier und da verlangsamen, wollte dennoch nicht aufhören.
Seit dieser Zeit haben sich mir viele Fragen beantwortet, meine Vernunft half mir, mein Sein in der Welt geschmeidiger werden zu lassen, meine Empfindungen jedoch wurden davon gerade einmal flüchtig angerührt.
Tatsächlich hat erst eine Filmszene etwas Neues in mir ausgelöst: Bruno Ganz und Otto Sander beobachten als Engel Damiel und Cassiel das Leben einer Großstadt, einem auf dem ersten Blick ganz gewöhnlichen Leben. Doch gerade im Kleinen entdecken sie Tag um Tag ganz besondere Eigenheiten, die das Gewöhnliche ins Licht existenzieller Fragen rücken. Die Engel, die man auf ihren Streifzügen durch die Stadt oder über sie schwebend begleiten kann, leben rein geistig und von den Menschen unerkannt, mit Ausnahme einiger Kinder, die in ihrer Unbedarftheit in den Himmel blickten und die Welt frei von Kategorisierungen und Urteilen so nehmen, wie sie sich ihnen zeigt. Eingeweihte wissen längst, dass es sich um den mehrfach ausgezeichneten Film „Der Himmel über Berlin“ von Wim Wenders handelt.
Damiel und Cassiel sitzen am Abend in einem Sportwagen hinter dem Schaufenster eines Autohauses und unterhalten sich über die Erlebnisse ihres Tages. Nachdem sie sich über ihre außerordentlichen Momente der letzten Stunden ausgetauscht und von den Augenblicken, in denen die Menschen ihre Anwesenheit spürten, berichtet haben, schwärmt Damien: „Es ist herrlich, rein geistig zu leben und Tag für Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein was Geistiges zu bezeugen“, doch gleich im nächsten Satz schwenkt er um: „Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte nicht mehr so ewig drüber schweben, ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erst fest macht. Ich möchte bei jedem Schritt oder Windstoß ,jetzt, – und jetzt und jetzt‘ sagen können und nicht immer seit ,je und in Ewigkeit‘.“ Damien bedauert: „Die ganze Zeit, wenn wir schon mal mittaten, wars doch nur zum Schein“ und dann malt er sich aus, wie es wäre, könnten sie sich selbst einmal spüren. „[…] endlich ahnen, statt immer alles zu wissen.“
Cassiel lässt sich von dieser Sehnsucht Damiens ergreifen und reflektiert wehmütig ihre Engelexistenz: „Allein bleiben, geschehen lassen, ernst bleiben, – wild können wir nur in dem Maß sein, wie wir unbedingt ernst bleiben. Nichts weiter tun als anschauen, sammeln, bezeugen, beglaubigen, bewahren, Geist bleiben, im Abstand bleiben, im Wort bleiben.“ (2)
Wenn ich sage, diese Szene hat mich zutiefst angerührt, war das keine bloße melancholische Momentaufnahme. Ich spürte in diesem Moment, wie meine ganze Sinnsuche mir nicht weiterhalf, diese geistigen Diskurse, in denen man immer höher über allem zu schweben empfand, der Versuch, das Gesamte zu erfassen und darunter die Gegenwart nur noch als in eine umrissene Zeitspanne eingebettet zu erleben.
Die Endlichkeit in kleinen Momenten erkennen, wenn man nach getaner Arbeit die Stiefel unter dem Tisch auszieht, derartiges hatte ich gedanklich schon oft durchgespielt. Sich an etwas halten zu können, statt über allem zu herrschen (ein Dilemma, das ebenso Camus’ Figur des Caligula erleiden musste). Diese Filmszene gab mir, mit all der hoffnungsvollen Melancholie, das zurück, was mir, auf mich alleine gestellt, immer wieder wie trockener Dünensand durch die Finger gerieselt war. Sie war meine Bestätigung, dass alles durch seine eigene Begrenzung erst gut sei.
Dass es eine Kunstform war, die dem seit Jahren in mir angelegten Aufbäumen gegen die Sinnlosigkeit einen lebendigen Weg wies, halte ich für keinen Zufall. Die Kunst berührt Sensoren, die der auf reine Vernunft basierende Verstand nicht impliziert. Nicht viel anders muss es auch Albert Camus erlebt haben, wenn er beim Anblick von in Stein gemeißelter Kunst festhielt: „Schaffe Kunstwerke und treibe keine Ästhetik; entdecke neue Wahrheiten und treibe keine Theorie oder Erkenntnis“ (3), wenn er in den Ruinen von Tipasa aufblühte: „Wir suchen weder Belehrung noch die bittere Weisheit der Größe […] Hier überlasse ich anderen, an Maß und Ordnung zu denken […] Es ist nicht leicht, der zu werden, der man ist und die eigene Tiefe auszuloten.“ (4) Oder wenn er die ganz simple Botschaft: „Die Kunst ist für mich nicht alles. So soll sie wenigstens ein Mittel sein“ (5), aufschrieb.
Meine Hingezogenheit zu Albert Camus ist entsprechend keine rein geistige. Beim Lesen seiner Romane und Novellen fühlte ich mich wohl, sprachlich und thematisch. Ich hatte gleich gespürt, hier schreibt niemand aus der Distanz. In seine Essays konnte ich mich erst allmählich hineindenken, vor allem, wenn es um historische Bezüge ging, die mir noch nicht geläufig waren. Die Dramen waren ein weiteres Glied, durch das sich alles mehr und mehr miteinander verknüpfte und verdichtete. Spätestens, als ich von seiner politischen Haltung erfuhr und seiner journalistischen Arbeit, – vor allem im Widerstand gegen die Nazis –, wurde mir klar: Wir sollten Camus nicht als rein historische Person betrachten, sein Denken reicht über seine eigene Lebenszeit hinaus und kann unsere Gegenwart in vielfältiger Weise beflügeln.
Es ist kein Widerspruch, eine sensible Person hinter dem gefeierten Schriftsteller vorzufinden, Camus’ besondere Empfindsamkeit, die er nicht verleugnen konnte, hat ihn zu diesem großartigen authentischen Autoren werden lassen.
Holger Vanicek, September 2020
Anmerkungen
1 Die Romane von H. Vanicek sind unter Sebastian Ybbs erschienen.
2 Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, 1987.
3 Tagebücher, II., 105 (G. Ferrero).
4 Hochzeit des Lichts, 10 ff.
5 Tagebücher, I., 14.