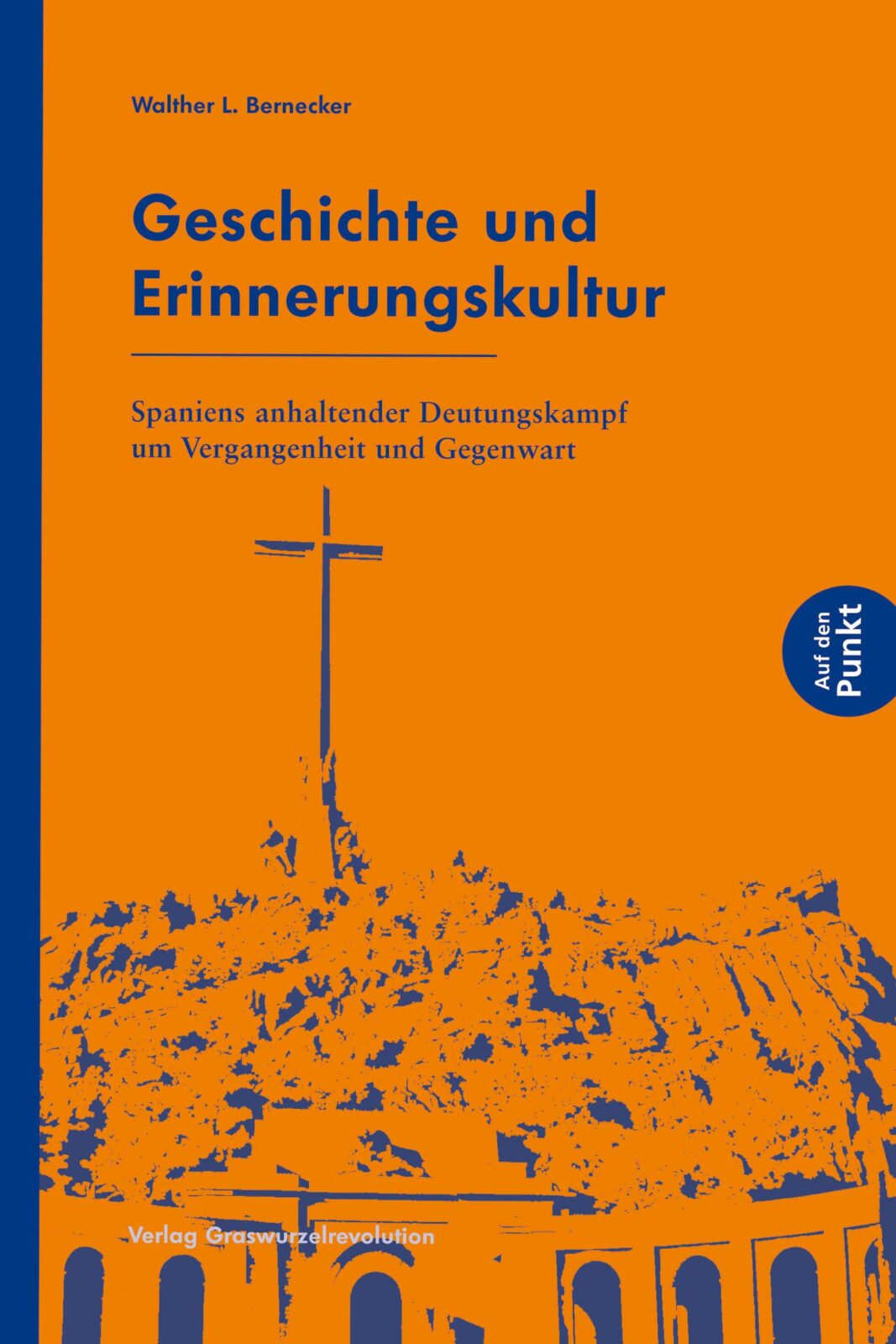Inhalt
Spaniens anhaltender Deutungskampf um Vergangenheit und Gegenwart
Vergangenheitsaufarbeitung in der Transition
Historiographie und erste gesetzgeberische Schritte
Regionalisierung und Formveränderung der Erinnerungsarbeit
Vom „historischen“ zum „demokratischen“ Erinnerungsgesetz von 2022
Schlussbetrachtung: Gedenkkulturen im Widerstreit
Ausblick: Mythen und die Zukunft der Erinnerungsarbeit
Literatur
Leseprobe
Spaniens anhaltender Deutungskampf um Vergangenheit und Gegenwart
Die Aufarbeitung von Kriegs- und Diktaturverbrechen kann sehr unterschiedlich erfolgen; sie ist aber in praktisch keinem der von dieser Problematik betroffenen Länder einfach. Der Wunsch, dass die in einem Krieg oder einer Diktatur verübten Untaten geahndet und Täter zur Rechenschaft gezogen werden, ist in den meisten Gesellschaften ein weitverbreitetes Verlangen. Allerdings ist der auf die Diktatur folgende Rechtsstaat zumeist nicht in der Lage, die hohen gesellschaftlichen Erwartungen von Gerechtigkeit zu erfüllen, da er sich an einen selbstauferlegten Normen- und Regelkatalog halten muss, der ihm Grenzen setzt (vgl. Ganzenmüller 2017, S. 11–21).
Postdiktatorische Transformationsgesellschaften sind mit der Frage der (straf-)rechtlichen Ahndung von Verbrechen ganz unterschiedlich umgegangen. Natürlich steht dem Rechtsstaat bei der Ahndung von Diktaturverbrechen das Strafrecht als Instrument zur Verfügung. Zugleich aber stellen sich den Gerichten zahlreiche strukturelle Hindernisse in den Weg: Mit Hilfe des Strafrechts lässt sich nur individuelle Schuld feststellen, was im Fall von Diktaturverbrechen häufig sehr schwierig ist – man denke nur an die schwierige Beweisführung bei ungenügender Aktenlage, an die Gefahr der Verjährung, an die nur bruchstückhafte Rekonstruierbarkeit einzelner Verbrechen, an die Elitenkontinuität gerade im Justizapparat, an das Rückwirkungsverbot etc. Staaten und Gesellschaften, die ein autoritäres oder diktatorisches Regime überwunden haben, sehen sich der großen Herausforderung gegenüber, den Übergang von Gewalt- und Willkürherrschaft zu rechtsstaatlicher Demokratie so zu organisieren, dass anhaltende und fortwirkende Folgen von schwerstem Unrecht überwunden werden können. Deren Opfer fordern mit Recht Aufklärung der begangenen Verbrechen seitens der Regierung und Behörden, die strafrechtliche Verurteilung der dafür Verantwortlichen, materielle und immaterielle Entschädigung und Garantien dafür, dass es keinen Rückfall in die Barbarei geben könne. Dieser Opferperspektive steht häufig eine gesamtgesellschaftliche Perspektive gegenüber, die eher auf Befriedung und Versöhnung zielt und dabei durchaus in Konflikt mit den berechtigten Anliegen der Opfer geraten kann (vgl. Hoeres / Knabe 2023).
Um mögliche Unvereinbarkeiten von Recht und Gerechtigkeit zu überwinden, bietet sich ein alternatives Verständnis von Gerechtigkeit an, das nicht auf Bestrafung abhebt, sondern auf eine Wiederherstellung des sozialen Friedens in der postdiktatorischen Gesellschaft. Diesen Ansatz verfolgen zumeist Wahrheitskommissionen, die zum Beispiel in Afrika und Lateinamerika als Instrumente der transitional justice eingesetzt worden sind. In anderen Fällen kam es zu umfassenden Amnestien, die vorübergehend einen scheinbaren Ausgleich schaffen, in den meisten Fällen aber von einem Großteil der Bevölkerung als ungerecht empfunden werden, da sie zu weitverbreiteter Straflosigkeit führen; außerdem können sie den Prozess der Demokratisierung diskreditieren (zur Transitional Justice im Rahmen der spanischen Erinnerungspolitik vgl. Tamarit Sumalla 2013).
[…]
Spanien ist in mehrerlei Hinsicht ein besonderer Fall. Ganz offensichtlich ist das Ziel der Vergangenheitsaufarbeitung – eine Befriedung der Gesellschaft herbeizuführen – nicht gelungen, denn zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Bändchens ist die politisch-ideologische Auseinandersetzung um die Kriegs- und Diktaturaufarbeitung noch in vollem Gange, spaltet die Gesellschaft und gibt Anlass zur pessimistischen Vermutung, dass die tiefen Deutungsdifferenzen bezüglich der Vergangenheit noch lange andauern und die spanische Gesellschaft weiterhin spalten werden. Was die strafrechtliche Ahndung schwerer Menschenrechtsverletzungen und die Durchführung von Gerichtsverfahren gegen administrativ oder politisch Verantwortliche für Diktatur und Repression betrifft, muss einleitend gleich darauf hingewiesen werden, dass es eine strafrechtliche Aufarbeitung der franquistischen Verbrechen im Bürgerkrieg und während der Diktatur nicht gegeben hat. Das bedeutet aber nicht, dass es keinerlei Auseinandersetzung mit der franquistischen Gewaltvergangenheit gegeben hat. Ganz im Gegenteil: Die Aufarbeitung der Franco-Verbrechen hat zwar erst spät begonnen, griff dann aber umso schneller und tiefgreifender um sich und ist noch lange nicht beendet. Eine systematische Erinnerungspolitik, die sich auf die Opfer von Bürgerkrieg und repressiver Diktatur konzentrierte, setzte in Spanien erst sehr spät ein. Erinnerungspolitik als solche gab es im Land aber schon sehr früh, praktisch seit dem Bürgerkrieg; sie bezog sich aber ausschließlich auf die „für Gott und Spanien Gefallenen“ (Caídos por Dios y por España) und diente dem Mythos einer „nationalen Gemeinschaft“ des angeblich „wahren Spanien“. Die Erinnerung an das republikanische Spanien und an die zur Verteidigung der Demokratie Gefallenen wurde bewusst verdrängt, ja: unterlag der damnatio historiae. Die in Monumenten, Gedenktagen, religiös-politischen Feierlichkeiten und Denkmälern zum Ausdruck kommende, vom franquistischen Regime betriebene Erinnerungspolitik war exkludierend, sie bezog sich ausschließlich auf die Gefallenen des „nationalen“ Lagers, das heißt der putschistischen Seite. Die offiziell massiv praktizierte Gedächtnispolitik diente nur den ideologischen Zielen der franquistischen Diktatur (zur Erinnerungskultur des Franquismus vgl. Arco Blanco 2022). Diese bis 1975 betriebene Erinnerungspolitik findet im Folgenden nur marginal Berücksichtigung; der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf der nach Francos Tod betriebenen Vergangenheitsaufarbeitung.
Besprechungen
Reiner Wandler in: taz vom 9. Januar 2024
Aufarbeitung des spanischen Faschismus
Schwerwiegende Vergangenheit
Walther Bernecker erklärt in seinem Buch „Geschichte und Erinnerungskultur“, wie das Leid der Opfer in der Franco-Diktatur bis heute bekämpft wird.
Spanien wird dieser Tage von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht. Die Rechte protestiert gegen die Wiederwahl des Sozialisten Pedro Sánchez zum Ministerpräsidenten und gegen seine Bündnispolitik mit den Parteien aus der nach Unabhängigkeit strebenden Peripherie.
Sie führen Fahnen aus Zeiten der Franco-Diktatur mit sich, rufen ewiggestrige Parolen und singen faschistische Hymnen. Es mobilisiert nicht nur die rechtsextreme Vox, drittstärkste Fraktion im spanischen Parlament, sondern auch die konservative Partido Popular (PP).
Spaniens Konservative haben keinerlei Berührungsängste. Sie gehen überall dort mit Vox zusammen, wo es zur Mehrheit reicht. Fünf Regionen und über 130 Gemeinden werden von einer Rechtskoalition regiert. Und überall ist eine der ersten Amtshandlungen die Streichung aller Programme, die der Vergangenheitsaufarbeitung dienen.
Zuschüsse gestrichen
Es gibt keine Zuschüsse mehr für die Suche nach Massengräbern, in denen bis heute, über 80 Jahre nach Ende des spanischen Bürgerkriegs, mehr als 100.000 Opfer der Faschisten liegen. Und dort, wo die Namen derer, die 1936 gegen die Republik putschten und Massaker unter Demokraten, Gewerkschaftern und Linken anrichteten, dank staatlicher Politik von Straßen und Plätzen verschwunden waren, kehren diese auf Straßenschilder zurück.
Der ehemalige Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg und Spezialist in spanischer Kultur und Politik, Walther Bernecker, nimmt sich in seinem neuen Werk „Geschichte und Erinnerungskultur“ des „Deutungskampfs um Vergangenheit und Gegenwart“ des Themas an. Er versucht dem deutschen Publikum zu erklären, wie es möglich ist, dass bis heute in Spanien um die Deutung der Vergangenheit gerungen wird – eine Debatte, die in Deutschland, mit Ausnahme der Ultrarechten, längst geklärt und die Verurteilung des Nazismus gesellschaftlicher Konsens ist.
Bernecker spannt bei seiner historischen Einordnung der (fehlenden) Erinnerungskultur den Bogen vom Ende des Bürgerkriegs bis heute. Er zeigt auf, wie in 40 Jahren Diktatur nur derer gedacht wurde, die auf der „nationalen Seite“ kämpften. Verteidiger der Republik galten bis zum Ende der Diktatur als Feinde Spaniens. Doch wer nach General Francos Tod und dem Übergang zur Demokratie eine Aufarbeitung der dunklen Vergangenheit erwartete, sah sich getäuscht.
Auffällige Zurückhaltung
„In den auf Francos Tod folgenden zwei Jahrzehnten legten die politischen Eliten (egal welcher Couleur) in der Frage der Vergangenheitsaufarbeitung eine auffällige Zurückhaltung an den Tag“, schreibt Bernecker. Es lag zum einen am Wunsch nach Aussöhnung und zum anderen an der Angst vor erneutem Konflikt. Diese gesellschaftliche Amnesie wurde gar als „Kultur des Übergangs zur Demokratie“ verklärt. Ein „klarer demokratischer Bruch mit der Diktatur“ blieb aus, konstatiert Bernecker.
Erst zum Jahrtausendwechsel – 25 Jahre nach Ende der Diktatur – sollte sich dies ändern. Es entstand eine soziale Bewegung zur Erinnerung an Opfer der faschistischen Repression. Familien begannen die sterblichen Überreste ihrer Angehörigen zu suchen, die ohne Gerichtsverfahren erschossen und verscharrt worden waren. Die Politik folgte zögerlich, 2007 wurde ein erstes „Gesetz zum historischen Gedenken“ erlassen, 2022 folgte das „Gesetz des demokratischen Gedenkens“. Erstmals werden Familien bei ihrer Suche nach den Verschwundenen unterstützt.
Faschistische Namen verschwanden aus dem Straßenbild. Der Leichnam Francos wurde aus einem Mausoleum in den Bergen Madrids in ein Familiengrab umgebettet. Das Gleiche gilt für den Gründer der faschistischen Falange und einen der wichtigsten faschistischen Putschgeneräle an Francos Seite.
Proteste von rechts
Jeder dieser Schritte war von rechten Protesten begleitet. „Das Spanienbild der Ultranationalisten – in Teilen auch das des Partido Popular – benötigt eine zusammenhängende und begeisternde Historie, um ihr nationales Narrativ mit Glanz präsentieren zu können“, resümiert Bernecker. Der erbitterte Kampf gegen jedwede Aufarbeitung der jüngsten Geschichte ist ein Kampf um die ideologische Hegemonie, darum, was Spanien ist und sein soll.
„Sánchez oder Spanien“ ist oft zu hören. Für die Rechte – Vox und PP – ist der Sozialist Pedro Sánchez, der mit Unterstützung der gesamten Linken und der Unabhängigkeitsparteien aus Katalonien, dem Baskenland und Galizien Vox und PP den Weg an die Macht versperrte, ein „Feind Spaniens“ und ein „Vaterlandsverräter“.
Berneckers Band ist der perfekte Einstieg für all diejenigen, die verstehen wollen, wie dies über 40 Jahre nach Ende der Franco-Diktatur mitten in Europa möglich ist.
Volker Dotterweich in: Das Historisch-Politische Buch, 71 (2023) 3–4, S. 470
Die düster-verfremdete, schemenhafte Grafik des Valle de los Caídos („Tal der Gefallenen“) auf dem Außenumschlag dieses Bändchens hat Symbolcharakter. Sie verweist auf die wohl spektakulärste, zugleich höchst umstrittene und zweifellos polarisierende Aktion der seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert gewandelten spanischen Erinnerungspolitik: die 2019 verfügte Entfernung der sterblichen Überreste Francisco Francos aus jenem gigantischen Mausoleum, das der Diktator für Zigtausende von Toten des Bürgerkriegs aus dem Fels der Sierra de Guadarrama, unweit des Escorial, von Zwangsarbeitern hat schlagen lassen. Überzählige Katakomben wurden mit Gefallenen der republikanischen Kriegsgegner verfüllt. Seitdem umgab das monumentale Massengrab der erinnerungspolitische Mythos einer nach den Gräueln des Krieges versöhnten „nationalen Gemeinschaft“ (S. 11). Die propagandistische Phrase diente gleichwohl in erster Linie der Legitimation des franquistischen Regimes. Vor diesem Hintergrund erscheint die 2023 verfügte, quasi “entsakralisierende” Umbenennung der Gedenkstätte in die rein geografische Ortsbezeichnung „Valle de Cuelgamuros“ nur konsequent. Die genannten Daten markieren zugleich die zeitlichen Eckpunkte der vorliegenden Betrachtung von Walther L. Bernecker. Der Autor hat sich wie kein anderer Historiker des deutschen Sprachraums die Erforschung der Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs und seiner Folgen zur Lebensaufgabe gemacht. Aus profunder Kenntnis der iberischen Zeitgeschichte unterzieht er die Konjunkturen der spanischen Erinnerungspolitik seit Francos Tod (1975) und die sich parallel dazu entwickelnde demokratische Erinnerungskultur bis in die unmittelbare Gegenwart einer ebenso anschaulichen wie eindringenden Analyse. Die kurzgefasste Darstellung schreibt seine grundlegende, zusammen mit Sören Brinkmann erarbeitete Rezeptionsgeschichte des Spanischen Bürgerkriegs von 2006 fort, bringt sie gewissermaßen auf den aktuellen Forschungsstand (vgl. „Kampf der Erinnerungen“, 377 Seiten, Verlag Graswurzelrevolution). Einmal mehr macht Bernecker bewusst, mit welcher Leidenschaft das konservative, franco-affine Spanien, das die Erosion der amnestiegestützten „Mauer des Schweigens“ über die Verbrechen des Bürgerkriegs lange zu verhindern suchte, und das moderne, demokratische Spanien, das die Wahrheit über die Repressions- und Gewaltpolitik der Franco-Diktatur ans Licht bringen will, um die Deutungshoheit über die Vergangenheit ringen. Was hier vor Augen geführt wird, ist zugleich ein Kampf um den Anspruch der betroffenen Familien, über das Schicksal ihrer vom Regime verfolgten Angehörigen Gewissheit zu erhalten, um ihren Anspruch auf Exhumierung der in Massengräbern, oft auch nur in Straßengräben Verscharrten, auf würdige Bestattung und Wiedergutmachung. Es ist ein Kampf um den „Denkmalsturz“, um die Entfernung von Denkmälern, Gedenktafeln, Straßen- und Ortsnamen, die das franquistische System verherrlichen. Es ist ein erbittertes Ringen um die „moralische und juristische Rehabilitation der Repressionsopfer“. Zuletzt, im Oktober 2022, setzte die sozialistische Regierung Sánches ein „Gesetz zur demokratischen Erinnerung“ durch. Es verurteilt unter anderem die Menschenrechtsverletzungen des Franco-Regimes, annulliert die politisch-ideologisch motivierte Rechtsprechung der franquistischen Gerichte und verfügt – gegen heftigsten Widerstand seitens des Partido Popular und von Vox – die Thematisierung der franquistischen Repression im Schulunterricht. Bei aller Sympathie für das demokratische Spanien verschweigt Bernecker nicht, dass die Auseinandersetzung über die Deutung der Vergangenheit und der Streit über Formen und Inhalte der Erinnerungskultur im politischen Alltag und im Umfeld von Wahlen von beiden politischen Lagern bis zur Stunde instrumentalisiert wird. Und er widerspricht allen Illusionen, das Ziel der spanischen Vergangenheitsarbeit könnte annähernd erreicht sein. Denn, so bereits sein einleitendes Statement, „die politisch-ideologische Auseinandersetzung um die Kriegs- und Diktaturaufarbeitung ist noch im vollen Gange, spaltet die Gesellschaft und gibt Anlass zur pessimistischen Vermutung, dass die tiefen Deutungsdifferenzen bezüglich der Vergangenheit … die spanische Gesellschaft weiterhin spalten werden“ (S. 10).