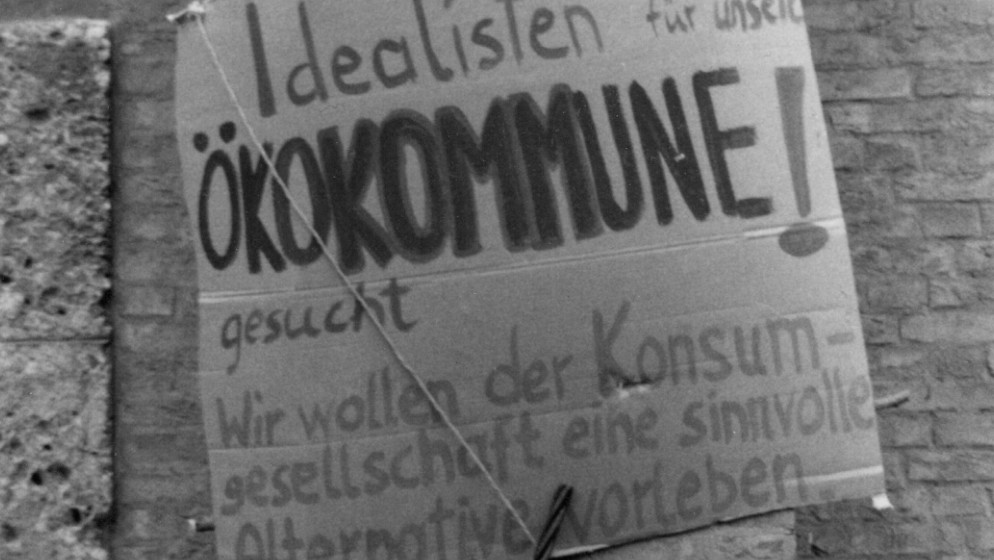Mit der unverhofften Grenzöffnung im November 1989 war Bewegung in die Berliner Ökodorfbewegung gekommen. Aus Hoffnungen und Träumen entstanden Projekte, manche scheiterten, andere bestehen bis heute.

Bis 1989 hatten sich Ökodorf-Aktivist*innen aus Westberlin nach Westdeutschland orientiert. Nach dem Mauerfall hatte Berlin plötzlich ein Umland, in dem fast unbegrenzte Möglichkeiten alternativen Lebens aufschienen. Eine massenhafte Wanderung von Ost- nach Westdeutschland hinterließ brachliegende Ländereien und Gebäude. Da drängte sich die Idee auf, mit einer ökologischen Siedlungsbewegung in umgekehrter Richtung die verlassenen Gegenden neu zu beleben.
Aus der „Ost-West-Begegnung Selbstorganisierte Lebensgemeinschaften – Kommunen, Ökodörfer, spirituelle Gemeinschaften und andere alternative Lebensformen“ im Juni 1990 in Kleinmachnow (siehe Teil 1, GWR 443) und weiteren Veranstaltungen, Reisen etc., waren Freundschaften und auch Projekte hervorgegangen. Mit meinen Kindern war ich oft zu Besuch in Babe, einem kleinen Dorf in der Prignitz, nicht weit von Neustadt (Dosse), etwa hundert Kilometer nordwestlich von Berlin. Dort wohnte auch Reinhard Zabka im Sommeratelier seines Lügenmuseums, und es gab einige ökologisch engagierte Bewohner*innen. In Babe lernte ich Leute aus dem Westberliner Bezirk Kreuzberg kennen, die dabei waren, im Berliner Umland mit öffentlichen Fördermitteln ökologische Projekte zu organisieren. Sie fragten mich, ob ich nicht mitarbeiten möchte. Mir gefiel der Gedanke, meinen Öko-Aktivismus in einer weitgehend selbstbestimmten Lohnarbeit fortzuführen. Und so begann ich im Frühjahr 1991 meine Tätigkeit bei der Atlantis gGmbH, einer „gemeinnützigen Gesellschaft für Umwelttechnik und Berufsperspektiven“.
Atlantis betrieb eine Reihe ökologischer Werkstätten in Berlin, für Photovoltaik und thermische Solarenergie, Windkraft, ökologisches Bauen und Begrünung. In den Projekten in Ostdeutschland kamen noch Pflanzenkläranlagen hinzu. Der Trägerverein ajb (Allgemeine Jugendberatung) richtete nach und nach mehrere Hundert öffentlich geförderte Arbeitsplätze ein, mit denen Langzeiterwerbslose oder Menschen mit Psychiatrie- oder Knasterfahrungen fit gemacht werden sollten für den ersten Arbeitsmarkt. Immer wieder tauchte die Idee auf, aus den Werkstätten heraus Kollektivbetriebe zu gründen. Mir ist aber kein einziger Fall in Erinnerung, wo das wirklich funktioniert hätte.
Kahlschlag und Geldregen
Im Frühjahr 1993, als ich schon nicht mehr bei Atlantis war, kamen drei ehemalige Kollegen aus Frankfurt/Oder zu mir. Ich arbeitete damals – vor meinem Umzug ins Projekt A nach Neustadt/Weinstraße (siehe GWR 441 und 442) – für ein paar Monate bei STATTwerke, einem damals noch genossenschaftlichen Beratungsunternehmen, das unter anderem für Kollektive und Landprojekte tätig war. Nach der Wende war die öffentliche Treuhandanstalt geradezu über die Volkseigenen Betriebe in der DDR hergefallen, um sie in die kapitalistische Marktwirtschaft zu überführen. Es fand ein unglaublicher Kahlschlag statt, oft nur vermeintlich marode Firmen wurden abgewickelt, so dass in Ostdeutschland massenhaft Menschen arbeitslos wurden, unter anderem viele Ingenieur*innen. Atlantis hatte auch ein Projekt in Frankfurt/Oder, die drei Ingenieure kamen zu mir und meinten: „Unser Chef hat gesagt, wir könnten einen Kollektivbetrieb gründen, kannst du uns dabei helfen?“. Es war nicht die beste Ausgangsbasis, das war mir sofort klar, und so wurde auch nichts daraus.
Wie viele soziale Träger finanzierte auch Atlantis seine Arbeit aus Mitteln der Arbeitsförderung, des Berliner Senats und des Landes Brandenburg, und aus europäischen Fördergeldern. In meiner Zeit bei Atlantis war ich im Aufbau und der Finanzierung von Projekten in der ehemaligen DDR tätig. In Babe bauten wir ein großes ABM-Projekt auf (ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme), mit Windrad, regenerativen Energien, einem Bauernhof mit vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen etc. Es sollte ein touristischer Anziehungspunkt werden, so dass auf lange Sicht feste Arbeitsplätze entstehen. Es war eine verrückte Zeit damals. Einerseits der Kahlschlag in der ehemaligen DDR, gleichzeitig wurden Fördergelder ohne Ende über dem Land ausgekippt. In Brandenburger Ministerien und Serviceeinrichtungen der öffentlichen Hand wurden einige Leute aus der Westberliner Alternativszene eingestellt. Ich erinnere mich, dass wir einmal mit einem Antrag auf Förderung von etwa 100.000 DM für Ökoprojekte zu einem Ministerium gingen. Die Mitarbeiterin winkte müde ab und meinte, wir sollten das nochmal neu konzipieren und noch eine Null an die Antragssumme dran hängen. Wahrscheinlich mussten die so viel Geld unter die Leute bringen, dass sich die Arbeit für so einen sechsstelligen Betrag nicht lohnte.
Privatisierung hat viele Gesichter
An größere Staatsknete-Diskussionen, wie sie zehn Jahre zuvor teils erbittert geführt wurden, kann ich mich nicht erinnern. Die Landschaft der Bildungs- und Beschäftigungsträger kam ja teilweise aus der Fraktion der Befürworter*innen von Staatsknete-Finanzierung, während viele Kollektivbetriebe das kritisch gesehen hatten. Da wo ich zur Wendezeit unterwegs war, wurde eher ganz ungebrochen zugegriffen, und ich habe selbst den Ehrgeiz gespürt, diese historische Chance zu nutzen und möglichst viel Finanzierung für alternative Projekte zu ermöglichen. Schließlich waren wir die Guten – oder hielten uns zumindest dafür. Wer darauf aus war, konnte in den unübersichtlichen Nachwendejahren auch für sich selbst einiges rausschlagen. So gab es Leute, die kauften privat Häuser und vermieteten sie an geförderte Projekte, die sie selbst oder Freund*innen betrieben. So wurde Privateigentum öffentlich finanziert.
In dem ABM-Projekt in Babe gab es dann um die einhundert Stellen – das waren sogar ein paar mehr als das Dorf Einwohner*innen hatte. Ein spannendes Projekt machten wir in Neu-Zittau in der Nähe von Erkner, nur kurz hinter der südöstlichen Stadtgrenze von Berlin, auf dem Kesselberg. Das war eine ehemalige Stasi-Abhöranlage, ein riesiges Waldgrundstück mit mehreren Gebäuden. Wir errichteten dort Solaranlagen, ein Windrad und begannen mit dem Bau einer Pflanzenkläranlage. Den ostdeutschen Kolleg*innen erklärte ich die Besonderheiten der Mehrwertsteuer – so etwas hatte es in der DDR nicht gegeben – und dass Sparen keine gute Idee sei. Denn wenn die für ein Jahr angesetzten Fördermittel nicht verbraucht wurden, dann mussten sie zurückgegeben werden und konnten nicht ins nächste Jahr übertragen werden, um sie dann vielleicht sinnvoller auszugeben.
An den Projektstandorten und auch anderswo versuchten wir die lokalen Verwaltungen davon zu überzeugen, sich eigene Ver- und Entsorgungsstrukturen aufzubauen, statt sich in die Abhängigkeit von Konzernen oder Zweckverbänden zu begeben. Eine eigene regenerative Stromversorgung und Abwasserentsorgung mit Pflanzenkläranlagen wäre weitaus günstiger gewesen, und hätte zumindest bescheidene bezahlte Arbeit vor Ort geschaffen, als endlose Leitungs- und Rohrkilometer verlegen zu lassen, für die dann andere abkassieren. Die Großen und Stärkeren haben gewonnen, und so wurden oft überdimensionierte zentrale Kläranlagen mit viel öffentlichem Geld errichtet. Leidtragende sind die Nutzer*innen, die bis heute sehr hohe Gebühren entrichten müssen. 2016 musste sogar eine voll funktionstüchtige und mehrfach preisgekrönte Pflanzenkläranlage der ökologischen Modellsiedlung Landhof Schöneiche bei Berlin wegen dem Anschlusszwang abgerissen werden.
Projektzentrum Kesselberg
Noch zu meiner Zeit bei Atlantis tüftelten wir an einem langfristig tragfähigen Betreiberkonzept für den Kesselberg. Das Grundstück sollte von der Treuhand erworben werden, gemeinsam mit einem weiteren Bildungsträger und der Gemeinde. Später kam es wohl zum Streit, die taz titelte „Eine Utopie, die am Alltag scheiterte“ (18.07.1996). Neben unterschiedlichen Interessen, die nicht zum Ausgleich kamen, und menschlichen Unverträglichkeiten, war es wohl auch ein Ost-West-Konflikt. Mitte 1996 kaufte Atlantis den Kesselberg alleine. Eineinhalb Jahre später wurden Fördermittel gekürzt und die Bank weigerte sich, einen Kredit zu gewähren, um die Zeit bis zur Auszahlung einer nächsten Fördermitteltranche zu überbrücken. Atlantis musste Anfang 1998 Insolvenz anmelden.
Das Grundstück wurde von Leuten aus der Soliszene mit rebellischen Bewegungen in Lateinamerika besetzt. Als es 2003 zur Zwangsversteigerung kam, ließ der ostdeutsche Kesselberg-Verein, der im Konflikt mit Atlantis den Kürzeren gezogen hatte, den Besetzer*innen freiwillig den Vortritt. So konnte der Verein „Ökologisches Kulturzentrum Kesselberg“ das Gelände zum Schnäppchenpreis von 100.000 Euro – für nur zehn Prozent des ursprünglichen Kaufpreises – übernehmen. Über die Jahre fanden viele Camps und Projektentwicklungswerkstätten auf dem Kesselberg statt. Ich war 1996 nach Berlin zurückgekommen und beteiligte mich zeitweilig, konnte mich jedoch nicht einmal entscheiden, mir dort ein Freizeitdomizil einzurichten. Ohne Auto ist es mühsam dort draußen, und mit dem Fahrrad zum Bahnhof Erkner geht es entweder durch den Wald oder über eine Landstraße, die (zumindest damals) mordsgefährlich war. Heute ist von dem Projekt nicht mehr viel zu hören, es entwickelte sich eine wohl recht ungeregelte Bewohner*innenschaft.
Die Bahro-Biedenkopf-Connection
Der frühere DDR-Dissident Rudolf Bahro gehörte zur Ökodorf-Bewegung (siehe GWR 443). Nach der Wende baute er an der Berliner Humboldt-Universität ein „Institut für Sozialökologie“ auf. Im Juli 1991 hielt der damalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) dort einen Vortrag: „Eine Wirtschaftsordnung für GAIA. Plan und Markt vor der Belastungsgrenze des Planeten“. In der anschließenden Diskussion erklärte er sich bereit, Selbstversorgungsprojekte in Sachsen zu unterstützen, wenn sie „seriös“ seien. Sogleich schickte Rudolf Bahro ihm ein Konzept mit Argumenten zur globalen Notwendigkeit solcher alternativer Lebensmodelle und ihrer besonderen Bedeutung für die neuen Bundesländer.
An einer Konferenz „Neue Lebensformen“ auf Gut Frohberg, einem Landprojekt von zugewanderten Wessis in der Nähe von Meißen, nahmen im Juni 1992 mehr als 300 Interessierte teil. Die sächsische Landesregierung wurde durch Hermann Kroll-Schlüter, den Staatssekretär im sächsischen Landwirtschaftsministerium, vertreten. Ein Teilnehmer berichtete anschließend, dass es manchen aus dem Osten unangenehm aufgestoßen sei, wie westlich dominiert die Podien besetzt gewesen seien. Auch Meditationen und Körperübungen hätten sie irritiert. Damals gingen ja reihenweise Politiker*innen und Manager*innen (ganz überwiegend Männer) nach Ostdeutschland, für einen kräftigen Zuschlag auf ihr reguläres Gehalt – böse Zungen sprachen in kolonialistisch-rassistischer Tradition von „Buschzulage“. Wie Biedenkopf kam auch Kroll-Schlüter aus NRW. Dieser bekräftigte nochmals, dass die Landesregierung bereit sei, ein Selbstversorgungsprojekt zu unterstützen, und dafür Land und eine Anschubfinanzierung zur Verfügung zu stellen.
Lebensgut Pommritz
Ganz konkret bot die sächsische Regierung ein Landgut in der Nähe von Dresden an. Da saßen wir nun, in der Ökodorf-Gruppe „Selbstversorgung als Selbstbestimmung“ und überlegten, was wir damit machen. Seit einiger Zeit war auch Dieter Halbach mit dabei. Er hatte früher, zur Hochzeit des Anti-AKW-Widerstands, im Wendland gelebt, und dann eine Landkommune in der Toskana gegründet, wie so viele damals (siehe Oya Nr. 6 Jan./Febr. 2011). Ich hatte ihn mal in Italien auf dem Hof „Il Capanno“ besucht, als er noch versuchte Leute zu finden, die benachbarte leerstehende Höfe übernehmen. Das Anwesen lag abseits, mit meinen Kindern musste ich einen weiten Weg durch den Wald laufen. Als wir ankamen, regnete es. Ein warmer Sommerregen, wir zogen uns aus und tanzten, es war wunderschön. Aber dort zu leben, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Nun wohnte Dieter in Berlin und wurde eine der zentralen Personen der Ökodorf-Gruppe, nachdem deren Gründer Jörg Sommer sich zurückgezogen hatte. Nach der Konferenz auf Gut Frohberg schrieb er: „Es gibt im Osten die Möglichkeit, brachliegendes Land, Gebäude und öffentliche Mittel zu nutzen, und so auch auf die örtlichen Probleme zu reagieren. Viele Menschen suchen Arbeit, Gemeinschaft und Perspektiven, und haben dabei eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum praktischen Beginn, wie sie im Westen kaum noch vorhanden ist. Und es gibt dort immer noch so etwas wie die Suche nach einer gesellschaftlichen Utopie. Für diese gesellschaftliche Dimension war das Treffen in Frohberg beflügelt durch die Vision Rudolf Bahros und durch die praktischen Angebote des Staatssekretärs Hermann Kroll-Schlüter. Ein Hoffnungsschimmer auf eine Kooperation mit der sächsischen Landesregierung wurde sichtbar. Die verschiedenen Themen, die breite Teilnahme an den spirituellen Übungen und die Pionierstimmung im Zeltlager und in den Hofruinen spiegeln: Hier geht es ums utopische Ganze, nicht um individuellen Vorteil und ländlichen Rückzug. Doch dieses ‚Aufgehen im Größeren‘ – utopischen, gesellschaftlichen, kollektiven – ist gleichzeitig auch die Schwäche der Bewegung. Es fehlen Persönlichkeiten und Initiativen. Um die Chancen nutzen zu können, brauchen die Gruppen ein selbstbewusstes Profil, eine Konzeption und ausreichend Erfahrung.“ (CONTRASTE – Monatszeitung für Selbstorganisation, Ausgabe 96, Sept. 1992).
Aus unserer Ökodorf-Gruppe konnte sich keine*r vorstellen, nach Sachsen zu gehen. Ein früherer Mitstreiter aus Rudolf Bahros Gemeinschaft Niederstadtfeld in der Eifel, sowie sein Mitarbeiter Maik Hosang von der Humboldt-Universität machten sich dann daran, eine Gruppe aufzubauen und gründeten das Lebensgut Pommritz. Es entstand eine Art Landkommune mit gemeinsamer Ökonomie, gemeinsamem Kochen, alle arbeiteten was sie wollten oder konnten. In den ersten Jahren war das Projekt mit ABM-Stellen gut finanziert. Das waren damals keine entwürdigenden Ein-Euro-Jobs, sondern es gab tarifliche Bezahlung wie im öffentlichen Dienst – allerdings nach Ost-Tarif. Diese Ungerechtigkeit, dass für die gleiche Arbeit im Westen mehr bezahlt wurde als im Osten, zog sich mindestens bis ins Jahr 2008, und wurde bei der Jahressonderzahlung nach TVÖD erst 2019 abgeschafft.
Die fast paradiesischen Zustände in Pommritz waren schnell vorbei, als die ABM-Stellen nicht mehr verlängert wurden. Sicher gab es auch vorher schon andere Probleme im Projekt, einerseits idealistisch überhöhte Erwartung daran, wie Menschen sich in Gemeinschaften entwickeln, andererseits Enttäuschungen darüber, wenn Leute doch zuerst an sich selbst dachten. Spätestens als das Geld knapp wurde, zerfiel die Gemeinschaft. 2014 erwarb der österreichische Unternehmer Heinrich Kronbichler das Lebensgut und rettete es damit vor dem finanziellen Ruin. Er betreibt dort ein Seminarhaus und mit Maik Hosang eine „interaktive Philosophie-Erlebniswelt ‚Sophia‘“. Die ursprünglichen Bewohner*innen sind nach und nach weggezogen.
Endlich raus aus Berlin!
Die Gruppe um Dieter Halbach erwarb 1993 als ersten Schritt zum Ökodorf einen Hof in Groß Chüden, einem Ortsteil von Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Vier Jahre später begannen einige der Bewohner*innen im 25 Kilometer entfernten Poppau mit dem Aufbau des Ökodorf Sieben Linden. Heute leben dort etwa 140 Menschen. Ich zog nicht mit nach Sachsen-Anhalt. Von den radikalökologischen Ideen hatte ich mich immer mehr entfernt, und ich wollte meine Kinder weder auf eine ostdeutsche Schule schicken, und sie den dort üblichen autoritären Zuständen aussetzen, noch sie unter den besonderen Bedingungen einer selbstorganisierten Freien Schule lernen lassen. Ich war selbst Waldorfschülerin gewesen und hatte unter anderem unter diesem Etwas-Besonderes-Sein (müssen) sehr gelitten. Meine Kinder sollten ebenso „normal“ aufwachsen wie alle anderen auch.
Als Redakteurin der CONTRASTE fuhr ich oft zum Plenum nach Heidelberg. Es ergab sich, dass ich bei der Gelegenheit auch Freund*innen in Neustadt an der Weinstraße besuchte, und so die WESPE kennenlernte, das „Werk selbstverwalteter Projekte und Einrichtungen“. Mir gefiel die Idee des Projekt A, vor allem fand ich jedoch die Leute dort sympathisch und die Gegend wunderschön. Nach vielen Kennenlernbesuchen entschied ich mich, dort hinzuziehen. In der Projektzeitung Stichpunkte schrieb ich im November 1992:
„Vom ‚besseren Leben‘ – Warum ich mit Anna und Olli nach Neustadt kommen möchte.
Eigentlich ist das ganz einfach: Statt weitere Jahre in Berlin zu verbringen und vom ‚besseren Leben‘ auf dem Land zu träumen – irgendwann mal wird alles anders – hab ich nun beschlossen, mich endlich einzulassen auf das Heute. Weil mir mit zunehmendem Alter immer klarer wird, daß die Zukunft genau in diesem Moment beginnt, und ich mein Leben nicht aufschieben kann. Der Entschluß, zum nächsten Sommer (wenn Olli zur Schule muß) aus Berlin wegzugehen, steht also.
Und warum gerade Neustadt? Von allen Projekten, die ich bisher besucht habe, entspricht mir Euer Verhältnis von Nähe und Distanz am ehesten: Keine Kommune, wo alles geteilt wird (was mich bedrängen würde), aber auch keine unverbindliche Dorfgemeinschaft oder Stadt-Szene (wo ich mich allein fühlen würde). Ich kann mir gut vorstellen, meine sozialen Beziehungen bei Euch nach meinen Bedürfnissen zu gestalten, und die Frage, was ich mit anderen teilen möchte, langsam und diesen Beziehungen entsprechend anzugehen. Dazu gehört für mich die politische Arbeit – gemeinsam Wege aus der lähmenden Ratlosigkeit finden – ebenso, wie z.B. zusammen Musik zu machen – ich möchte eine Samba-Percussion-Gruppe aufbauen.
Dabei ist mir wichtig, daß der Wespe-Zusammenhang überschaubar ist, und doch aus vielen Menschen besteht; was es darüberhinaus an Projekt-A-Vernetzung gibt, interessiert mich sehr. Meine Eindrücke während unseres Besuchs waren zwar auch widersprüchlich, und ich hab einiges von Euren Konflikten mitbekommen, aber unterm Strich glaube ich, daß ich mich in dem, wie Ihr miteinander umgeht, bewegen und einbringen kann. Der Grund für mich, nach Neustadt kommen zu wollen, ist also eindeutig das soziale Umfeld, die Einbindung in einen größeren menschlichen Zusammenhang. Eigentlich wollte ich ja immer aufs Land – und werde mich hier auch für die Schaffung einer solchen Möglichkeit engagieren – aber das ist erstmal ziemlich abstrakt, und eher eine Perspektive für die nächsten Jahre.“
Im Sommer 1993 packte ich also meine Sachen und zog mit den Kindern von Berlin nach Neustadt/Weinstraße – wo wir allerdings nur für drei Jahre blieben (siehe GWR 441 und 442).
Elisabeth Voß
Dies ist ein Beitrag aus der aktuellen Druckausgabe der GWR. Schnupperabos zum Kennenlernen gibt es hier.